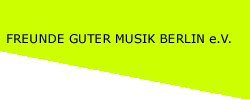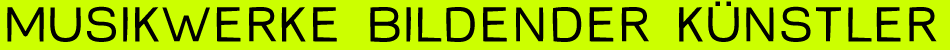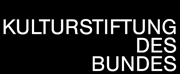CEVDET EREK
»Bergama Stereo«
2019
Architektonische Konstruktion mit 34-Kanal-Sound & PerformanceprogrammLautsprecher, Verstärker, Computer, Audiointerface, Holz, Metall
H 4,50 m x B 14 m x L 9,25 m
In der Architekturinstallation mit Sound Bergama Stereo bezieht sich der in Istanbul lebende Künstler und Musiker Cevdet Erek auf die Gestalt, die historische Funktion und die forwährende Rezeptionsgeschichte des in Berlin befindlichen Pergamonaltars und kreiert eine Neuinterpretation dieses bedeutenden hellenistischen Bauwerks aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert. Die erhaltenen Fragmente des Altars wurden Ende des 19. Jahrhunderts vom ursprünglichen Standort in der heutigen Westtürkei nach Berlin transportiert.
Die große Bedeutung, die der hellenistischen Altaranlage in dem gerade gegründeten Deutschen Kaiserreich seit den 1880er Jahren zukam, ist eng verbunden mit der aufblühenden Entwicklung der Antikenrezeption in Wissenschaft und Kultur. Darüber hinaus spielte sie eine wichtige Rolle im kulturellen Wettstreit des Kaiserreichs mit anderen europäischen Großmächten. In Berlin wurde dem Altar 1901 ein eigenes Museum eröffnet, das bis heute zu den bestbesuchten Museen der Stadt gehört. Das Pergamonmuseum wird derzeit renoviert, sodass der Altar über mehrere Jahre nicht öffentlich zugänglich ist.
»Bergama Stereo« ist eine ortsspezifische Arbeit. Sie ist konzipiert für zwei Schauplätze, die auf unterschiedliche Weise mit der Geschichte des Pergamonaltars und dem historischen Kontext seiner Rezeption und Rekonstruktion verbunden sind. Nachdem das Werk im Rahmen der Ruhrtriennale 2019 in der beeindruckenden Industriearchitektur der Turbinenhalle auf dem Gelände der 1902 errichteten Jahrhunderthalle in Bochum gezeigt wurde, ist die Installation nun in der ebenso beeindruckenden Historischen Halle des Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin zu erleben.
Zum Titel des Werks: Bergama ist der türkische Name für das antike Pergamon sowie der heutigen Stadt und des Bezirks in der Provinz Izmir. Das Wort >stereos< bedeutete im Altgriechischen ursprünglich >fest<. Hier steht es unter anderem für die Methode der multi-direktionalen und perspektivischen Tonwiedergabe – analog zum natürlichen Hören. Stereoklang entsteht im Audioplayback und bei Verstärkersystemen von Liveperformances üblicherweise durch die symmetrische Anordnung von zwei Einzellautsprechern oder zwei Lautsprechergruppen. In »Bergama Stereo« wird dieser audiovisuelle Aspekt mit der symmetrischen Architektur des Altars und seiner zwei Flügel verknüpft.
Cevdet Erek hat »Bergama Stereo« in seinen Dimensionen für die beiden, jeweils charakteristischen historischen Hallen in Bochum und Berlin konzipiert. Die Proportionen des Pergamonaltars bleiben im verkleinerten Maßstab von knapp 1:2 erhalten, die markante schwarze Architektur befindet sich jeweils an der Kopfseite der Hallen. Der berühmte Gigantenfries des Altars, auch Gigantomachie-Fries genannt, wird in einer Multi-Kanal-Komposition interpretiert, die den Raum beschallt. Der Sound übernimmt hier die zentrale Rolle zur Schaffung einer tönenden Architektur, die die visuellen Elemente des originalen Altars ersetzt und in ein multi-dimensionales Narrativ übersetzt, das sich nicht nur auf die Geschichte und Vergangenheit sondern auch auf die Gegenwart bezieht. Der Skulpturenfries wird ersetzt durch einen monumentalen Lautsprecherfries mit einer Komposition, die sich aus verschieden Sounds und Klangquellen speist und über 34 separate Lautsprecherkanäle in den Raum projiziert wird. Analog zum nur fragmentarisch erhaltenen originalen Pergamonfries und seinen auf der Grundlage der Architekturfunde rekonstruierten Stützelementen wechseln sich die Lautsprecher mit leeren Lautsprechergehäusen ab.
Der neue akustische Fries interpretiert und transformiert die Darstellungen im Gigantenfries auf vielfältige Weise: Der Kampf der Olympischen Götter mit den sich gegen ihre Herrschaft auflehnenden Giganten des Untergrunds wird durch die vielkanaligen, verräumlichten Sounds auf verschiedene heutige Kämpfe übertragbar und so für das Publikum in einem abstrakten Modus neu erfahrbar gemacht. Die ästhetische Bezugnahme auf die elektronische Musik- und Clubkultur der letzten Jahrzehnte in Berlin spielt dabei ebenso eine Rolle wie Klänge der traditionelle Basstrommel Davul und Tanzrhythmen der Region um Bergama.
Cevdet Erek verwendet in seinen Arbeiten zumeist sehr reduzierte Soundelemente. Sie bestehen aus perkussiven Mustern, akustisch oder elektronisch generiert, aber auch aus Wort- und Satzfragmenten in verschiedenen Sprachen oder onomatopoetischen Elementen und Geräuschen. Diese Soundpatterns werden vom Künstler vor Ort in eine vielkanalige Komposition übertragen, die den Raum über eine Vielzahl von Lautsprechern mit einem rhythmischen Klang füllt. Die Bewegungen und Höraktivitäten der Besucherinnen und Besucher bestimmen die Wahrnehmung der Komposition. An jedem Ort des Raums ist die Komposition anders zu hören: Nähert man sich dem Lautsprecherfries, sind dies einzelne Sounds, die sich, je weiter man sich von ihnen entfernt, überlagern und den Rhythmus in den Raum tragen. Diese Rhythmen, Pulse und Schwebungen könnten auch zu tänzerischen Bewegungen verleiten – das akustische Erleben beschränkt sich in diesem Falle nicht auf das Hören. Die Komposition wird jeweils während des Aufbaus der Installation vor Ort bestimmt, sie verändert sich dabei, wird ergänzt und variiert.
Wie schon in Bochum, ist auch in Berlin ein im Ausstellungsraum stattfindendes Konzert- und Performanceprogramm integraler Bestandteil der Präsentation. Es greift Themen und strukturale Aspekte der Architektur auf. Musiker und Musikerinnen sind eingeladen, sich mit den charakteristischen Merkmalen der Installation wie Symmetrie, Balance, Gegensatz und den inhaltlichen Aspekten des Werks wie Geschichte, Ritual, Macht, Kampf, Streit, Vertreibung und Migration auseinanderzusetzen.
Die Ausstellung in Berlin findet zum 20-jährigen Jubiläum von »Musikwerke Bildender Künstler« statt. Die Veranstaltungsreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt von Freunde Guter Musik Berlin e.V. und der Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Seit 1999 wurden bereits musikalische Werke und Installationen von Hanne Darboven, Yves Klein, Hermann Nitsch, Rodney Graham, Stephen Prina, Lawrence Weiner / Peter Gordon, Käthe Kruse, Carsten Nicolai, Janet Cardiff & George Bures Miller, Cory Arcangel, Egill Sæbjörnsson & Marcia Moraes, Ryoji Ikeda, Susan Philipsz, Saâdane Afif, Christian Marclay, Ari Benjamin Meyers und Jorinde Voigt im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin und in der Neuen Nationalgalerie präsentiert.